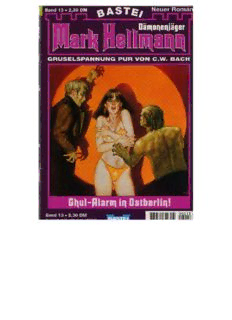Table Of ContentGhul-Alarm in Ostberlin!
C.W. Bach
»Natürlich fahr ick 'nen Triebwagen. Det is meene Bestimmung.
Schließlich hab ick 'nen janz ausjeprägten Trieb.« Kurt Bolte, Fah-
rer bei den Berliner Stadtwerken, lachte meckernd, doch das La-
chen sollte ihm bald vergehen. Eine unheimliche Begegnung
stand ihm bevor. Bolte, ein dicklicher Mittvierziger mit schütterem
Haar, verließ den Personalraum am U-Bahnhof Alexanderplatz,
auf dem an diesem Dienstagmorgen im September schon reger
Verkehr herrschte. Es war kurz vor sechs Uhr. Bolte stieg in die U
6 ein, deren Fahrer er ablöste. Die beiden Männer schüttelten sich
kurz die Hand. Der eine war bartstoppelig und übernächtigt, der
andere - Bolte - stets guter Laune. Trotz seines Alters hatte Bolte
nur immer eines im Kopf: Frauen und immer wieder Frauen. Al-
lerdings hauptsächlich theoretisch, denn so viele Chancen hatte
er nicht.
Bolte überprüfte die Anzeigenskalen, warf einen kurzen Blick auf
die Uhr und beschleunigte den Zug. Er saß im Führerhaus. Hinter
ihm, durch eine Wand getrennt, waren die Fahrgäste.
Aus sechs Wagen bestand dieser U-Bahnzug, der zu ungefähr
siebzig Prozent besetzt war.
Bolte fuhr vom Alexanderplatz in Richtung Warschauer Straße.
Die Tunnelwände flitzten vorbei. In der Röhre kam einem die Ge-
schwindigkeit noch viel höher vor, doch Bolte hatte sich dran ge-
wöhnt.
Der Zug rauschte durch die ewige Nacht hier unten.
Plötzlich entdeckte Bolte zwei Gestalten auf den Gleisen! Er er-
schrak, handelte aber sofort. Er leitete die Vollbremsung ein. Und
nun erkannte er im Scheinwerferlicht einen jungen, dunkelhaari-
gen Mann in der Uniform der früheren DDR-Volkspolizei und ein
bildschönes, blondes Mädchen. Die beiden hielten sich bei der
Hand und streckten die andere dem heranrasenden U-Bahnzug
entgegen.
Die Bremsen packten, die Räder blockierten bald, und der Zug
glitt kreischend und funkensprühend über die Schienen. Fahrgäs-
te wurden von ihren Sitzen gerissen und flogen durcheinander. Es
gab ein paar Verletzte. Bolte biß die Zähne zusammen und hoffte,
daß sein Zug noch vor den beiden zum Stehen kam.
2
Endlos erschien ihm die Bremsstrecke. Obwohl er wußte, daß
die Entfernung zu kurz war, versuchte er doch alles, um zwei
Menschenleben zu retten. Er hoffte auf ein Wunder.
Gott, dachte er, stopp diesen Zug, laß mich die zwei nicht über-
fahren. Bitte nicht! Schon einmal hatte sich ein Selbstmörder vor
Kurt Boltes Zug geworfen, ein Anblick, der ihn jetzt noch, drei-
zehn Jahre danach, im Traum verfolgte. Springt von den Schie-
nen, ihr zwei! dachte Bolte. Weg da, weg!
Das Paar, der Vopo-Leutnant in voller Uniform und die bildschö-
ne Blondine, hatten urplötzlich vor dem dahinrasenden Zug ge-
standen. Bolte bebte, während er bremste. Innerhalb zweier Se-
kunden trat ihm der Schweiß auf die Stirn. In der dritten Sekunde
passierte es!
Es war sehr seltsam. Als ob die Zeit stehenbleiben würde, sah
Bolte, wie sich das junge Paar umarmte und zärtlich küßte. Sie
schauten sich tief in die Augen. Wie in Zeitlupe verfolgte Bolte,
wie der Zug den beiden näher kam. Er hörte das Kreischen der
blockierenden Räder auf andere Weise. Er beobachtete das Lie-
bespaar wie in Zeitlupe und wie durch ein riesiges Fernglas. Und
er bildete sich ein, alle Details zu erkennen, was bei den Lichtver-
hältnissen und in der Streßsituation eigentlich gar nicht möglich
gewesen wäre.
Er sah, daß die junge Frau in der Westmode der Sechziger Jahre
gekleidet war. Die Uniform des Leutnants entsprach ebenfalls
dieser Zeit. Bolte wußte es, er hatte damals in der DDR gelebt.
Die Vergangenheit schien noch einmal aufzuleben.
Noch einmal schauten ihn die beiden an, ein Blick, der sich tief
in die Seele des geschockten Angestellten bohrte. Dann öffneten
sich die Lippen der jungen Frau.
»Hütet euch vor den Ghulen!« sagte sie, was Bolte deutlich
verstand. »Brutus Kasput bedroht diese Stadt!«
Im nächsten Augenblick erfaßte der Triebwagenzug das junge
Paar. Sie gerieten unter die Räder, wurden weggerissen.
Der Zeitablauf änderte sich erneut. Alles fand nun wieder in
normaler Geschwindigkeit statt. Der abbremsende Zug schien
sogar noch zu beschleunigen. Die Funken, die Bolte zuvor in der
Luft gesehen hatte, flogen schneller. Das Kreischen von Metall auf
Metall klang ohrenbetäubend wie zuvor.
Bolte brachte den Zug endlich zum Stehen. Er hatte einen sau-
ren Geschmack im Mund. Dennoch griff er zum Mikrofon und
3
machte seine Durchsage an die Fahrgäste.
»Es hat eine technische Panne gegeben. Bewahren Sie bitte Ru-
he und bleiben Sie im Zug. Ist ein Arzt im Zug? Er soll bitte auf
der linken Seite aussteigen.«
Dann meldete Bolte das Unglück seiner Einsatzstelle. Rettungs-
fahrzeuge wurden losgeschickt und ein Notfahrplan in Kraft ge-
setzt.
»Sind die beiden mit Sicherheit tot?« fragte ihn der Disponent
von der Leitstelle entsetzt.
»Ich kann mir nicht vorstellen, daß sie noch leben. Ich habe sie
voll erfaßt. Tut mir leid. Es ist schrecklich.« Sich entlastend fügte
Bolte hinzu: »Sie haben sich umbringen wollen. Ich steige jetzt
aus und sehe nach ihnen. Bestimmt sind sie mitgeschleift worden.
Ich melde mich wieder.«
»In Ordnung. Tu das. Ambulanz und Störtrupp sind unterwegs.
Der Verkehr auf diesem Abschnitt eingestellt. Ersatzverkehr wird
eingerichtet. Ende.«
Bolte stieg aus, obwohl es ihm vor dem graute, was er sehen
würde. Vielleicht, wie durch ein Wunder, war ja doch eine Person
mit dem Leben davongekommen.
Mit aschgrauem Gesicht ging Bolte am Zug entlang. Eine Frau
um die Dreißig und vier Männer waren ausgestiegen. Die Frau
sagte, sie sei Ärztin, Internistin, um genau zu sein. Der jüngste
der vier Männer gab vor, Medizin zu studieren. Die anderen, die
wohl nur ihre Neugier befriedigen wollten, wies Bolte energisch
zurück.
»Steigen Sie wieder ein!« rief er. »Und bleiben Sie im Zug, bis
Sie weitere Anweisungen erhalten.«
Ein Mann sagte etwas auf Türkisch. Er blutete aus der Nase. Bei
der Vollbremsung hatte er sich den Kopf angeschlagen. Bolte gab
ihm einen Wink, in den Zug einzusteigen. Die Fragen anderer
neugieriger Fahrgäste, die in den offenen Türen standen und wis-
sen wollten, was geschehen sei, beachtete er nicht.
Mit der Ärztin und dem Medizinstudenten blickte er zunächst
unter den Zug. Da waren keine Blutspuren zu erkennen. Das Trio
ging am Zug entlang zurück, schaute unter die Wagen und kon-
trollierte das Gleisbett. Sie konnten nichts feststellen.
»Die beiden sind bestimmt überrollt worden und liegen weiter
hinten«, sagte Kurt Bolte. »Beeilen wir uns!«
Im Laufschritt rannten die drei zurück und suchten die Stelle,
4
wo Bolte den Volkspolizisten und die Blondine mit dem Zug er-
wischt hatte. Der Medizinstudent lief mitten auf dem Gleiskörper,
um nur nicht in die Nähe der Stromschiene zu gelangen. Der
kurzatmige Bolte folgte ihm mit einigem Abstand.
Auf dem Nachbargleis fuhr kein Zug mehr. Auch dieser Stre-
ckenabschnitt war vorübergehend gesperrt worden. Als die drei
an der Stelle waren, wo die Vollbremsung eingesetzt hatte, fehlte
jede Spur von dem Liebespaar auf den Schienen. Kurt Bolte faßte
es nicht. Er blinzelte, schaute verwundert und verstand die Welt
nicht mehr.
»Aber«, rief er, »das kann doch nicht sein. Ich habe die beiden
so deutlich gesehen, wie ich euch jetzt vor mir sehe. Mit Sicher-
heit habe ich sie überfahren.«
Die Ärztin und der Medizinstudent schauten sich an.
»Dann müßten die Leichen hier liegen - zumindest Leichentei-
le«, stellte die brünette, elegant gekleidete Internistin nüchtern
fest. »Sind Sie ganz sicher, daß da ein Paar auf den Schienen
war? Und daß der Zug sie erfaßt hat? Ich meine, vielleicht handelt
es sich um einen makabren Scherz, und die zwei sind im letzten
Moment zur Seite gesprungen und haben sich in Sicherheit ge-
bracht. Es gibt die verrücktesten Geschichten.«
»Passen Sie auf«, begann Bolte aufgebracht, milderte dann je-
doch seinen Tonfall. »Da standen ein Vopo-Leutnant und eine
wunderschöne Frau Hand in Hand auf dem Gleis. Ich habe sie
überfahren, weil der Bremsweg zu kurz war. - Sie sind unter den
Zug geraten, das schwöre ich! Die beiden trafen überhaupt keine
Anstalten, sich in Sicherheit zu bringen.«
»Dann müssen die beiden hier irgendwo sein«, sagte der lang-
haarige Medizinstudent. »Keiner wird von der U-Bahn überfahren,
steht dann einfach auf und geht weg.«
Hilflos schaute sich Bolte um und hob seine Handflächen mit ei-
ner Geste des Unverständnisses nach oben. Er konnte sich nicht
erklären, weshalb es keine Leichen und Blutspuren gab.
»Leiden Sie vielleicht unter Halluzinationen?« fragte die Inter-
nistin. »Nehmen Sie Medikamente? Drogen vielleicht?«
»Ganz gewiß nicht.«
Bolte wollte den Vorfall noch einmal ganz genau schildern, ein-
schließlich der von ihm wahrgenommenen Zeitverzögerung und
der Worte, die die Blondine an ihn gerichtet hatte. Doch den Zeit-
lupeneffekt und die Warnung der Blondine ließ er lieber weg.
5
Wenn er das sagte und eine Warnung vor Ghulen erwähnte, er-
klärten sie ihn glatt für verrückt.
Der Vorfall war so schon mysteriös genug.
*
Es war noch warm wie im Hochsommer. Ich saß auf dem Balkon
des Cafe »Kranzler« am Kudamm, hatte ein Bier vor mir stehen
und las schräg gegenüber an der Hauswand die Nachrichten der
BZ. Eine Anzeigetafel mit verschiedenen Zeilen und Buchstaben,
die sich jeweils drehten, brachte im Kurztext die wichtigsten Neu-
igkeiten des Tages. Auf dem Kudamm herrschte reger Verkehr.
Die Mädchen waren noch erfreulich knapp und reizvoll gekleidet.
Die Berlinerinnen hatten einen besonderen Chic, der mit dem
vielgepriesenen Charme der Pariserinnen durchaus konkurrieren
konnte. Soweit man hier von Berlinerinnen sprechen konnte. Un-
sere Hauptstadt war seit der Wiedervereinigung noch bunter und
internationaler geworden.
Ich erinnerte mich noch genau an jene Nacht im Oktober '89,
als die Mauer geöffnet wurde. Die ganze Nacht über waren wir
Jungs aus dem Osten durch Westberlin gezogen, hatten am Bran-
denburger Tor und auf der Mauer gesessen und es kaum fassen
können, daß die Vopos nicht auf uns schossen.
Dann standen wir vor den Auslagen und überlegten, wie wir an
Geld rankamen, um uns lange Entbehrtes leisten zu können.
Neunzehn Jahre alt war ich damals gewesen, hatte gerade mein
Abitur gemacht und begriffen, daß ich historische Augenblicke
erlebte. Westdeutsche Politiker hatten gesagt, jetzt müsse zu-
sammenwachsen, was zusammengehört. Die Sehnsucht nach
Demokratie und Freiheit waren stärker als die Planwirtschaft ge-
wesen.
Der Eiserne Vorhang war durchgerostet und eingestürzt. Ich er-
innerte mich an die Westberliner Mädchen, mit denen ich die
Wiedervereinigung auf meine Weise vollzogen hatte. Mit einer
sogar stehend an der Berliner Mauer. Das waren noch Zeiten ge-
wesen!
Für meine Freunde und mich war es sagenhaft gewesen, West-
Berlin zu erleben. Wir kamen aus einer Mangelversorgung in eine
Welt des Überflusses und des Überangebots. In Ost-Berlin hatte
6
es bis zur Wende im Vergleich zu den Glitzerfassaden und elegan-
ten Läden der westlichen Hälfte der Stadt grau und recht bieder
ausgesehen.
Seitdem hatten wir aufgeholt. Zwar nicht so schnell, wie es die
größten Optimisten gehofft hatten, aber in ein paar Jahren zogen
wir bestimmt mit dem Westen gleich. In jeder Beziehung. Die
Wiedervereinigung ist halt ein Riesenprojekt. Ohne Vorbild. Und
wir Menschen sind ungeduldig. Verständlicherweise.
Ich, Mark Hellmann aus Weimar, habe ein Faible für Berlin. Jetzt
war ich wieder mal da und wohnte mit Tessa Hayden zusammen
in einer Pension in der Uhlandstraße. Pit Langenbach, mein bester
Freund, Hauptkommissar bei der Weimarer Kripo, war in einem
Hotel am Kudamm abgestiegen. Er nahm an einem dienstlichen
Lehrgang teil, weil er die Karriereleiter hinaufklettern und bald-
möglichst Polizeirat werden wollte.
Tessa, Fahnderin bei der Weimarer Kripo, besuchte ebenfalls ei-
nen Lehrgang. Psychologische Schulung sowie Vorlesungen über
das Notwehrrecht. Außerdem übte sie bei einem Crashkurs das
Autofahren in Extremsituationen. Beides fand in der Nähe vom
Polizeipräsidium am Tempelhofer Damm statt.
Im Moment wartete ich auf Tessa und Pit. Es ging schon auf 18
Uhr zu. Allmählich hätten sie kommen können. Ich flirtete ein
wenig mit einer Blondine am Tisch gegenüber; besser gesagt, sie
mit mir. Ich wollte ja treu sein.
Ich nahm das Leben gern auf die leichte Schulter, auch wenn
ich als Träger des Rings eine besondere Bestimmung hatte und
ständig in größter Gefahr schwebte. Vielleicht genoß ich deswe-
gen jeden Tag, als ob es mein letzter wäre, freute mich meines
Lebens, wenn möglich, und versuchte, das Beste herauszuholen.
Den magischen Ring trug ich am Ringfinger der Rechten. Er be-
stand aus massivem Silber und hatte die stilisierten Buchstaben
M. N. mit einem stilisierten Drachen als Wappen darum.
Mit diesem Ring hatte es eine besondere Bewandtnis: Er zeigte
dämonische Aktivitäten mit einem schwachen Glimmen und Wär-
me an. Wenn diese Aktivitäten von superstarken Dämonen wie
Mephisto getarnt waren, war das wohl nicht oder nicht immer der
Fall. Zudem konnte ich mit diesem Ring durch die Zeit reisen,
wenn ich nämlich an einem Ort dämonischer Aktivität mit dem
Lichtstrahl des Rings das keltische Wort für »Reise« mit Buchsta-
ben des altgermanischen Futhark-Runenalphabets auf den Boden
7
zeichnete.
Und ich konnte magische Waffen mit dem Ring herstellen, die
allerdings nach einer Stunde ihre Kraft verloren. Weitere Fähig-
keiten des Rings kannte ich bisher nicht, doch es war möglich,
daß mir hier noch Überraschungen bevorstanden. Ich hatte über-
haupt schon allerhand erlebt, seit ich mir meiner Bestimmung als
Träger des Rings bewußt geworden war, eines Auserwählten, der
die Mächte des Bösen und der Finsternis zu bekämpfen hatte.
Seit Anbeginn der Zeiten dauerte dieser Kampf an, ein stetiges,
mächtiges Ringen, in dem ich eine Rolle spielte. Ich war im Jahr
1198 und im 16. Jahrhundert gewesen, im Erzgebirge und in
Schottland. Mit Klaus Störtebeker war ich gesegelt, als sein Maat,
und hatte mit ihm zusammen den Fliegenden Holländer Jan van
Duiwel bekämpft. Die Spinnenfrau Uma Araneae hätte ich fast
erledigt. Nur mit Schaudern erinnerte ich mich an sie und einige
andere Abenteuer.
Und ins Jahr 1975 war ich aus der Gegenwart zurückgereist, um
in Eisenach einen Werwolf zur Strecke zu bringen. Erledigt hatte
ich ihn dann in der Gegenwart. Mephisto, Erzdämon und Paladin
der Hölle, war mein Erzfeind und trug eine persönliche Fehde mit
mir aus. Den Vampir Dracomar hatte ich kennengelernt und be-
kämpft und viele andere Unwesen, um größeres Unheil zu verhin-
dern.
Ich wußte, daß die Mächte der Finsternis grausige Realität wa-
ren und die Menschen tagtäglich bedrohten. Manchmal wußte ich
selbst nicht, wo mir der Kopf stand, soviel stürmte auf mich ein.
Ich hatte viel gelernt in den vergangenen Monaten und meinen
Horizont erweitert. Ich stand an der Stelle, wo ich hingehörte,
und mußte mich ständig bewähren.
Das Geheimnis meiner Herkunft freilich, wer meine leiblichen El-
tern waren, hatte ich in der Zwischenzeit nicht lösen können.
Auch wußte ich noch nicht, was das Hexenmal auf meiner Brust
bedeutete, der siebenzackige schillernde Stern.
An der Anzeigetafel der BZ las ich jetzt: Spuk in der U-Bahn. Ein
paar kurze Zeilen meldeten, daß ein Fahrzeugführer der U-Bahn
zwei geisterhafte Personen auf den Gleisen gesehen und überfah-
ren hätte. Es seien jedoch keine Leichen gefunden worden. Der
Fahrzeugführer sei zum Psychologischen Dienst geschickt worden,
wo man ihn begutachten sollte.
Etwas später folgte eine weitere Meldung von Aktivitäten un-
8
heimlicher bleicher Gestalten im Rotlichtmilieu. Gangster und Dir-
nen seien angeblich von unheimlichen Erscheinungen bedroht
worden, einer Art Nosferatu, die aus den U-Bahnschächten sowie
der Kanalisation stiegen.
Ich las diese Meldungen mit Interesse, ohne zunächst viel damit
anfangen zu können. Mein Ring hatte in den drei Tagen, die ich
nun in Berlin war, keine Aktivitäten gezeigt, was mir sehr recht
war. Jeder Mensch brauchte mal Erholung.
Am Nebentisch, an dem die Blondine mit dem knappen rosefar-
benen Top und dem kurzen Rock saß, wurde über die Meldungen
gelacht.
»Was für ein Unsinn!« hörte ich und: »Haben wir heute den ers-
ten April?«
Ich prostete der Blonden zu. Das verstand sie falsch, setzte sich
gleich zu mir an den Tisch und meinte, wir sollten uns näher ken-
nenlernen. Ich dagegen saß auf heißen Kohlen und wartete auf
meine Freundin Tessa. Sie war eifersüchtig, und ich hatte den
Vorsatz gefaßt, sie nicht mehr so oft zu enttäuschen. Hoffentlich
wurde ich die Blondine los, bevor Tessa kam.
»Können wir zusammen was unternehmen?« fragte die Blondine
direkt. »Du gefällst mir.«
Sie legte die Gleichberechtigung so aus, daß sie die Männer an-
sprach, statt zu warten, bis sich einer traute.
»Ich bin Buddhist«, antwortete ich. »Leider habe ich mein
Mantra vergessen, meinen Spruch, ohne den ich bei der Meditati-
on echt aufgeschmissen bin, verstehst du? Bis es mir wieder ein-
fällt, darf ich mit keiner Frau was anfangen. Sonst ist das Mantra
für immer weg. Dann muß ich extra nach Tibet zu meinem Guru
ins Bergkloster. Das ist mir schon mal passiert. Ein Riesenzirkus,
kann ich dir sagen. Viel schlimmer, als wenn du deine EC-Karte
und sämtliche Ausweise verlierst und dir wiederbeschaffen
mußt.«
»Wie? Hast du'ne Meise? Mantras gibt es, soviel mir bekannt ist,
beim Hinduismus.«
»Beim Buddhismus auch. Frag Richard. Richard Gere, meine
ich, den Filmstar. Er ist auch ein Buddhist. Wir sind sechs Wochen
zusammen in einem tibetanischen Bergkloster gewesen. Da
kannst du 'ne Menge lernen, sogar barfuß über glühende Kohlen
und übers Wasser zu gehen. Doch mit dem übers Wasser laufen
ist es so eine Sache. Ich kriege immer nasse Füße dabei und hole
9
mir einen Schnupfen.«
Die Blondine polterte: »Du meinst wohl, weil ich blond bin,
kannst du mich veräppeln. Dabei hast du selbst blonde Haare.«
Sie wäre gleich beleidigt abgezogen. Doch in dem Moment ka-
men Pit Langenbach und Tessa durchs Cafe zu den Außentischen
auf der Terrasse vom ersten Stock. Tessas Pupillen verengten
sich. Sie marschierte direkt auf uns zu wie eine altgriechische
Rachegöttin.
»Sie stören«, sagte sie zu der Blondine. »Ich habe mit diesem
Herrn etwas sehr Persönliches zu besprechen. Wir kennen uns
nämlich schon länger.«
»Dann schreiben Sie sich sein Mantra auf, wenn er es sich sel-
ber nicht merken kann«, antwortete die Blondine, was Tessa nicht
verstand. »Tschau.«
Mit diesem Wort zog sie ab, sagte am Nebentisch kurz Bescheid
und verließ mit aufreizendem Hüftschwung das Cafe. Pit Langen-
bach, groß, mit dunklem Kurzhaar und mächtigem Schnauzer,
und Tessa setzten sich zu mir an den kleinen Tisch. Tessa, brü-
nett, mit schlanker, ranker Figur und grünen Hexenaugen, trug
einen Hosenanzug, den sie erst neulich gekauft hatte.
Pit und ich waren leger angezogen. Ich hätte mit den beiden,
die einen Teil meiner Geheimnisse kannten, gern die Zeitungs-
meldungen über die unheimlichen Vorkommnisse besprochen.
Doch Tessa hatte anderes im Sinn. Sie funkelte mich zornig an.
»Kann man dich nicht mal eine Stunde aus den Augen lassen,
ohne daß du dir gleich eine andere Frau angeln mußt, Mark? Jetzt
reicht es mir aber langsam. Neulich erst habe ich dich mit einer
anderen erwischt. Jetzt baggerst du diese Blondine an, obwohl du
genau weißt, daß ich gleich hierher zurückkomme.«
»Sie hat sich zu mir an den Tisch gesetzt.«
»Ach! Ganz plötzlich und ohne Aufforderung? Nächstens willst
du mir noch weismachen, das wäre deine Schwester!«
»Das wäre sogar möglich. Schließlich kenne ich meine Herkunft
nicht. Du weißt, im Alter von zehn Jahren, am 1. Mai, bin ich in
Weimar aufgegriffen worden, splitternackt, völlig verstört, mit
einem Lederriemen um den Hals, an dem dieser Ring hing.«
»Jetzt fang nur nicht wieder mit der Story von dem armen el-
ternlosen Knaben an, den die Hellmanns zu sich nahmen und a-
doptierten. Und der jahrelang wüste Alpträume hatte. Dein Ju-
gendtrauma, wenn du eins hast, gibt dir noch lange nicht das
10